Irgendwie muss man ja mit seinem Audiosignal in den Computer hineingelangen. Und irgendwie mit dem, was die Software an Geräuschen produziert, auf Boxen oder Kopfhörer. Ein Blick auf die Internetseiten der Händler stellt vor allem den Neuling oft vor einige Rätsel, hat sich doch in den letzten Jahren die Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Audio-Interfaces vervielfacht. Es gibt viele Ausstattungsmerkmale, von denen einige sinnvoll sind und andere für das, was man vorhat, eher unwichtig.

Für einen letztendlichen Kaufentscheid spielen zwei Bereiche eine Rolle: Die individuellen Anforderungen und das liebe Geld, das für Audiohardware maximal ausgegeben werden kann. Dieser Artikel soll als kleiner Führer im Dschungel der bunten Kisten mit all seinen Fachwörtern, Abkürzungen und Werbeversprechen dienen.
Wieviele Ein- und Ausgänge werden benötigt?
Eine grundlegende Einteilung der erhältlichen Geräte lässt die Anzahl der Ein- und Ausgänge zu. Die simpelste Form stellen Geräte dar, die über je einen Stereo-Eingang und Stereo-Ausgang verfügen. Mit ihnen kann man Stereosignale auf Boxen geben und auch Stereosignale aufzeichnen. Dies kann für viele Situationen ausreichend sein. Wenn ihr nur Musik mit internen Klangerzeugern macht, habt ihr unter diesen “2 In / 2 Out”-Interfaces (gezählt werden immer Mono-Kanäle!) eine reichhaltige Auswahl. Allerdings solltet ihr bedenken, dass die Einschränkungen sehr hoch sind. Die simultane Aufzeichnung von mehr als zwei Mono-Signalen oder einem Stereo-Signal ist unmöglich.
Eine Mehrkanal-Aufnahme ist beispielsweise für Schlagzeug sinnvoll. Auch Hardware-Klangerzeuger (Synthesizer, Sampler, Grooveboxen), deren Signale man gerne zur weiteren Bearbeitung im Computersystem aufnehmen möchte, haben häufig Einzelausgänge. Bei “multitimbraler” Verwendung (also verschiedener Sounds, die gleichzeitig aus einer Kiste kommen) und nur zwei Eingängen bedeutet das, dass jeder Sound einzeln und in Echtzeit aufgezeichnet werden muss, wenn man ihn im Rechner unabhängig von den anderen bearbeiten möchte.
Kann ich externe Hardware einbinden?
Auch die Einbindung externer Effektgeräte in das Harddiskrecording-Programm ist mit einer 2/2-Konfiguration unmöglich: Man bräuchte zumindest ein weiteres Ausgangspärchen, um ein Stereosignal aus dem System heraus zu bekommen und trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, das bearbeitete Signal auch abzuhören.
Soll die Hardware auch im Livebetrieb benutzt werden, ist es von Vorteil, wenn ihr dem Toningenieur mehr als nur ein Stereosignal zur Verfügung stellen könnt. Hat er etwa Beats und Solo-Sound getrennt voneinander an seinem Mischpult anliegen, kann er diese optimal bearbeiten. Schließlich kann man von der Bühne aus kaum einschätzen, wie es um die Balance der einzelnen Signale bestellt ist, das macht besser der Ingenieur. Software, die live eingesetzt wird, zeigt ihr Können und ihre Flexibilität erst bei der Verwendung mit mehrkanaliger Hardware: Wie ein DJ-Pult verfügen sie meist über die Möglichkeit, Signale mit einer “Cue”-Funktion vorhören und über Kopfhörer oder “Booth”-Lautsprecher testen zu können, bevor sie auf die P.A. zum Publikum geschickt werden. Einleuchtend: Wer in Surround arbeiten möchte, benötigt eine entsprechende Anzahl analoger Ausgänge (oder eine sogenannte AC3-Stream-Option, die mehrere Kanäle über eine Digitalschnittstelle ausgibt). Es ist selbstverständlich möglich, Live-Instrumente oder Sänger mit einem Interface aufzuzeichnen, das nur zwei Ausgänge hat. Allerdings muss man sich dann damit abfinden, dass alle beteiligten Personen ein identisches Signal hören müssen – und das wollen Künstler und Techniker selten: Der Aufnehmende möchte die Signalqualität beurteilen und muss dieses Signal dafür recht laut, klar und ohne Effekte hören. Wer spielt oder singt, tut dies oft zu einem Playback. Um eine gute Tonhöhen- und Groovekontrolle zu haben, ist das Playback entsprechend anders gemischt. Wichtig ist hier aber in erster Linie, dass der Sänger oder Instrumentalist sich wohl fühlt – nicht selten gehört dazu ein “schöngemischtes” Signal mit Effekten.

Wenn möglich symmetrische Ein- und Ausgänge verwenden
Wer also genau weiß, dass er seine Hardware ausschließlich dazu benötigt, die Klangerzeugung seiner Software über Monitor-Boxen abzuhören, ist mit einer 2-In-2-Out-Lösung gut bedient und kann das Geld in eine hochwertige Lösung investieren statt in viel Schnickschnack. Alle Anderen benötigen weitere Anschlussmöglichkeiten:Neben üblichen I/O-Konfigurationen 2×2, 2×4 und 4×4 findet man häufig 8×8, also acht analoge Eingänge und acht analoge Ausgänge, wodurch flexibles Monitoring, Multichannel-Recording und die vernünftige Einbindung von externen Synthesizern, Samplern und Effektgeräten möglich werden.
Auch die feste Verkabelung einiger Geräte und somit der Verzicht auf eine Patchbay oder schimpfende Nutzer hinter irgendwelchen Geräteracks sind eindeutige Vorteile von Multi-I/O-Interfaces. Symmetrische Eingänge und Ausgänge sind unsymmetrischen in jedem Fall vorzuziehen, weil die Verwendung symmetrischer Ausgänge, Eingänge und Kabel Störgeräusche unterdrücken kann. Sind Anschlüsse als Klinkenbuchsen ausgelegt, erkennt man oft nicht auf Anhieb, ob sie symmetrisch oder unsymmetrisch sind. Im Regelfall sind sie mit “balanced” bezeichnet oder mit “TRS”. Diese Abkürzung steht für “Tip, Ring, Sleeve” und wird im Deutschen als “Stereoklinke” bezeichnet, auch wenn darüber statt zweier Signlale nur ein symmetriertes geschickt wird. Wenn nichts zu lesen ist, ist dies meistens ein Hinweis auf fehlende Symmetrierung.
Viele Geräte (Synthesizer, Effektgeräte, HiFi-Geräte) haben leider nur unsymmetrische Ausgänge, so dass ihr die Notwendigkeit dieses Features ruhig von der Geräteumgebung des Audio-Interfaces abhängig machen könnt. Selten findet man Interfaces mit XLR-Anschlüssen. Diese sind dann immer symmetrisch. Aus Platzmangel auf dem Gerät werden manchmal sogenannte Peitschen benutzt. Das sieht aus wie ein riesiges Adapterkabel: Ein Multipin-Anschluss ist auf der einen Seite, die eigentlichen Input- und Outputbuchsen auf der anderen. Ärgerlich wird es, wenn einmal ein Verbindungskabel oder eine Buchse beschädigt wird.
Für dich ausgesucht
Digitale Schnittstellen im S/PDIF- oder ADAT-Format
Häufig haben größere Interfaces zwei elektrische S/PDIF Coaxial-Anschlüsse, welche über RCA-Buchsen (bekannt als analoger “Cinch”-Stecker von der HiFi-Anlage) jeweils zweikanalig digitales Audio senden und empfangen können. Grund genug für die Hersteller also, die Anzahl der I/Os mit “zehn” zu betiteln. Achtung: Oft kann man den Digitalausgang nicht individuell beschicken, da er parallel zum analogen Hauptausgang (führt also exakt das gleiche Signal) angelegt ist! Eingangsseitig muss man sich häufig zwischen einem analogen Eingangspärchen und dem S/PDIF-Input entschliessen. “10/10”-Interfaces ermöglichen also trotzdem in der Regel nur die simultane Nutzung von acht Ein- und acht Ausgängen. Eine Alternative zum “elektrischen” S/PDIF-Interface ist das “optische”, welches mit sogenannten “TOS-Link”-Buchsen arbeitet. Über sehr dünne Lichtwellenleiter-Kabel werden statt Spannungen Lichtimpulse versendet. Diese Glasfaserkabel sind sehr anfällig für Knicke und recht teuer. Selten findet man auch beide S/PDIF-Ausführungen an einem Gerät.Nutzen kann man dieses Consumer-Digitalinterface in Verbindung mit manchen Effektgeräten und Digitalpulten oder hochwertigen, externen Analog/Digital-Wandlern (und natürlich umgekehrt mit Digital/Analog-Wandlern). Für Channelstrips (meist Mikrofonvorverstärker, Equaliser und Compressor in einem Gerät) sind häufig A/D-Erweiterungskarten erhältlich. Viele HiFi-Geräte und Synthesizer haben ebenfalls eine derartige Schnittstelle, so dass sich die verlustbehaftete Wandlung von Digital zu Analog (im Gerät) und wieder umgekehrt (im Audio-Interface) vermeiden lässt. Das zweikanalige AES/EBU-Digitalinterface (mit XLR-Buchsen) lässt sich prinzipiell als professionelle S/PDIF-Variante beschreiben und ist nur selten und bei höherpreisigen Interfaces zu finden.
Richtig interessant wird es mit mehrkanaligen Digitalschnittstellen. Das ADAT-Format ist das Überbleibsel einer einstigen Revolution im Projektstudiobereich (dem ersten bezahlbaren Digital-Mehrspurrecorder) und ermöglicht die Übertragung von acht Kanälen mit 44,1 oder 48 kHz Samplerate und 24 Bit Wortbreite. Die Buchsen, Stecker und Kabel sind mit optischem S/PDIF identisch, häufig lässt sich die Funktion daher softwareseitig von ADAT auf S/PDIF umschalten. Reichen acht analoge Inputs nicht aus, lassen sich zusätzliche achtkanalige Mikrofonvorverstärker mit A/D-Wandlern oder Mischpulte per ADAT an diese Audiointerfaces anschließen.
Auch der Markt an stand-alone ADAT AD/DAs hat sich in den letzten Jahren erheblich vergrößert. Ab und zu unterstützen Audio-Interfaces den sogenannten “S-MUX”-Modus. Da Digitalsignale mit der doppelten Samplerate (also 88,2 oder 96 kHz) auch doppelt so viel Datendurchsatz benötigen, wird dabei im Gegenzug die übertragbare Kanalzahl von acht auf vier reduziert. Es gibt noch weitere digitale Anschlussmöglichkeiten. Das 56-kanalige MADI spielt bei Interfaces unter 1000 Euro aber keine Rolle, das sogenannte TDIF-Format verschwindet zusehends in der Versenkung.
Wird eine Audiohardware digital mit anderen Geräten verbunden‚ tritt schnell die Frage auf, welches Gerät die Aufgabe übernehmen soll, den digitalen Takt für alle zu generieren, also Samplerate-Master zu sein. Zwar ist bei digitalen Audiosignalen eine Taktungsinformation enthalten, auf die der Empfänger und seine A/D- und D/A-Wandler “gelockt” werden können, in größeren Setups ist jedoch schnell der Einsatz einer separaten Leitung mit der Bezeichnung “Wordclock” nötig. Manche Audiointerfaces können über eine BNC-Buchse (diese sieht dem Antennenanschluss ähnlich) auschliesslich zum Slave werden, jedoch keine eigene Clock ausgeben.
Auf die Qualität der Mikrofon-Preamps kommt es an
Sollen Gesangsaufnahmen gemacht werden, steht die Überlegung im Raum, sich für ein Interface mit integriertem Mikrofonvorverstärker zu entscheiden. Ein Mikrofonvorverstärker ist absolut notwendig, da Mikrofone einen viel geringeren Output als beispielsweise Synthesizer haben. Mittels “Gain” wird die Vorverstärkung eingestellt. In den letzten Jahren ist die Qualität der integrierten Mikrofon-Preamps von katastrophal auf “ordentlich” gestiegen. Immerhin eine gute Entwicklung, aber echte Glanzstücke sind im bezahlbaren Preissegment kaum zu finden. Ein guter Mikrofonvorverstärker kostet eben gutes Geld, und acht Mikrofonvorverstärker kosten eben achtmal gutes Geld. Aber vielleicht möchtet ihr euch ja nicht unbedingt weitere Kisten anschaffen, die wiederum für Kabelsalat sorgen könnten. Tipp: Die Hersteller von Analogpulten und bewährtem Outboard-Equipment sparen bei ihren Interfaces nicht an falscher Stelle und haben einiges an Erfahrung im Herstellen von Vorverstärkern.
Hochwertige Kondensatormikrofone benötigen 48V-Phantomspeisung
Im Regelfall möchte man Gesangsaufnahmen mit Kondensatormikrofonen machen. Röhrenmikrofone bringen ihre eigenen Spannungsversorgung mit, für die meisten anderen ist eine 48V-Phantomspeisung vonnöten. Auf deren Vorhandensein sollte ebenso geachtet werden wie auf ein Trittschallfilter zum Eliminieren niederfrequenter Störgeräusche (oft “High Pass” oder “Low Cut” genannt). Auch ein “Pad”, das bei sehr hohem Pegel zur Dämpfung eingesetzt wird, sollte vorhanden sein. Für die direkte Aufzeichnung von Gitarren und Bässen ist ein Eingang mit entsprechend schaltbarer Impedanz sinnvoll. Diese sind oft mit “Instrument” bezeichnet. Mager ist die Auswahl an hochwertigen Interfaces mit Plattenspieler-Anschluss. Neben der zusätzlichen Masseklemme ist dafür ein spezieller Vorverstärker mit eingebauter Entzerrerkurve notwendig. Schön ist es natürlich, wenn man direkt zwei Plattenspieler anschliessen kann.

Direktes Monitoring um Latenzen beim Abhören zu vermeiden
Ein leidliches Thema computergestützter Harddiskrecorder war früher oftmals das Monitoring. Jeder hat schon einmal erlebt, wie nervig es ist, die eigene Stimme auf dem Mobiltelefon mit einer kurzen Verzögerung zu hören. Das gleiche Problem entsteht durch Hardware- und Softwarebuffer, weil alle Eingangs- und Ausgangssignale jeweils kleine Sicherheitsspeicher durchlaufen müssen, die ein Delay entstehen lassen. Seit einigen Jahren bieten Hersteller von Audio-Hardware direktes Monitoring auf analoger (und somit verzögerungsfreier) Ebene an, bei dem das eingehende und das ausgehende Signal gemischt werden können. Arbeitet man ohne Mischpult, ist unbedingt auf diese Fähigkeit zu achten! Allerdings gibt es auch hier deutliche Unterschiede bezüglich Komfort und Flexibilität. Wichtig ist die Fähigkeit, das Eingangssignal mono mit dem Playback summieren zu können, sonst liegt die eigene Stimme nur auf dem linken Ohr, wenn man einen Eingang mit einer ungeraden Nummer wählt und auf dem rechten, wenn man einen Eingang mit einer geraden Nummer benutzt.
Manche Hersteller setzen auf zwei unabhängige Kopfhörer-Verstärker, was in Produktionssituationen ein Segen sein kann. Denn nicht immer können Lautsprecher eingesetzt werden; bei Laptop-Recordings “on location” beispielsweise. Eine voll ausgestatte Monitor-Sektion mit DIM (kurzfristige Absenkung des Abhörpegels, um die Einstellungen nicht verändern zu müssen), MONO und MUTE, separatem Monitoring-Level und Talkback-Mikrofon zur Kommunikation von Regie zu Studio findet sich leider nur bei ausgewählten Interfaces. Nur, wenn das der Fall ist, kann man das pultlose Studio realisieren. Eine richtig gute und bezahlbare Monitoring-Lösung für den Surround-Einsatz sucht man allerdings heute noch vergebens.

Kommunikation analoger und digitaler Geräte per Midi und Sync
Soll ein Klangerzeuger, ein Effektgerät oder ein Digitalpult vom Computer gesteuert werden, soll ein Masterkeyboard ohne USB-Interface zum Einsatz kommen oder der Computer mit einem weiteren verbunden und zeitsynchronisiert werden, muss ein MIDI-Interface her. Dieses ermöglicht das Senden und Empfangen von MIDI-Steuersignalen durch eine Software. Sind nicht zu viele MIDI-Geräte im Spiel, kann auf ein separates Multiport-Interface verzichtet werden, wenn das Audio-Interface MIDI In und Out bietet. Da diese Technologie preiswert und von hohem Nutzen ist, geben die Hersteller ihren Interfaces häufig einen MIDI-Input und einen -Output mit auf den Weg. Ungefähr drei Geräte können über MIDI-Thru in hintereinander geschaltet werden (“Daisy Chain”). Ist MIDI vorhanden, spricht zumindest hardwareseitig nichts mehr gegen eine Gerätesynchronisation mittels MC (“MIDI-Clock”) oder MTC (“MIDI-Timecode”).
Die Fähigkeit eines Interfaces, auf LTC- oder VITC-Timecode (also Audio- oder Video-Timecode) zu synchronisieren, muss hingegen oft teuer bezahlt werden. Daher sollte man sich gut überlegen, ob es wirklich vorkommen wird, dass per LTC (oft etwas unrichtig SMPTE genannt) zur Analogmaschine oder per VITC zum externen Videosignal synchronisiert werden muss. Wozu eine Funktion bezahlen, die nicht eingesetzt wird?
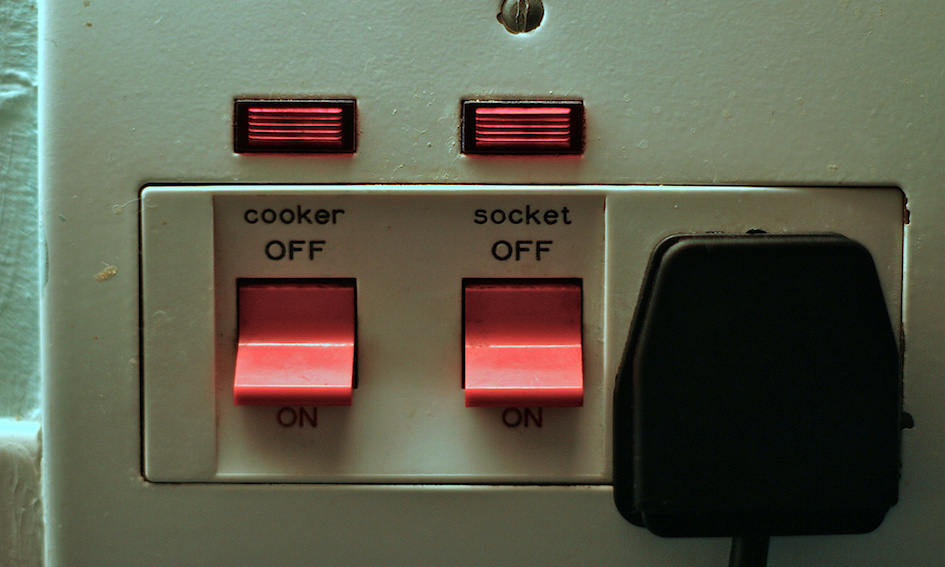
USB oder FireWire: Anschluss und Stromversorgung
Als Standard zum Anschluss von Audiohardware ist USB die unangefochtene Nummer Eins. Die Vorteile liegen auf der Hand: Transportabilität, geringe Herstellungskosten, integrierte Spannungsversorgung und Plug-and-Play. Nachteilig ist jedoch, dass an Computern oft eine Reihe von USB-Geräten angeschlossen werden, so dass es schnell zu Problemen mit dem Datenversand kommt. Die Übertragungskapazität von 12 MBit/s bei USB 1.1 reicht nur für die Übertragung weniger Kanäle aus. USB 2.0 kann mit maximal 480 MBit/s zwar wesentlich schneller sein, wird jedoch auf 12 MBit/s zurückgestuft, sobald ein einziges Gerät auf dem Bus diese Geschwindigkeit benutzt. Etwas teurere und größere Geräte verwenden oft FireWire 400 (meist einfach nur “FireWire” genannt), manche auch das noch schnellere FireWire 800. Der Hersteller mit dem Apfel bietet aus für viele nicht nachvollziehbaren Gründen bei seinen Mobilrechnern kein FireWire 400 mehr. Die größeren Mobilrechner verfügen zwar über FireWire, aber ausschliesslich 800. Leider haben PC-Laptops fast immer einen Mini-FireWire-Anschluss (“iLink”), welcher qualitativ nur eine halbe Stufe über dem Mini-Klinkenstecker angesiedelt werden kann: Ein Trauerspiel! die neue Generation portabler Apple-Computer bietet als Anschlussmöglichkeit nur noch USB 2.0 (MacBook) oder USB 2.0 und FireWire 400 (MacBook Pro) an. Arbeitet ihr mit einem Desktop-Rechner, könnt ihr in Erwägung ziehen, eine PCI-Karte zu verwenden. Diese sind zwar generell preiswerter, der Markt wird aber zunehmend dünner. Übrigens: Den Gedanken, dass man dann doch direkt die on-board Soundkarte verwenden könnte, bitte sofort aus dem Gehirn löschen. Wer einmal versucht hat, damit ernsthaft zu arbeiten, versteht diese Ansicht.
FireWire- und USB-Interfaces können “bus-powered” verwendet werden, also ohne separates Netzteil. FireWire 400 erlaubt die Leistungsaufnahme von bis zu 48 Watt, bei USB sind es nur 2,5. Diese recht geringe Zahl lässt Rückschlüsse auf die Audioqualität zu: Es erscheint vielmehr als Wunder, dass Geräte mit zwei integrierten Mikrofonvorverstärkern mit Phantomspeisung brauchbare Ergebnisse liefern. Gute Mikrofonvorverstärker verbrauchen eine Menge Strom, hochwertige AD/DA-Wandler ebenfalls. Bei über den Bus gespeisten FireWire-Interfaces ist die Situation zwar nicht so extrem, jedoch solltet ihr euch genau überlegen, ob ihr wirklich abseits der Steckdosen arbeiten müsst (um dann innerhalb von 50 Minuten euren voll geladenen Laptop-Akku zu leeren).
Welche Samplerate ist notwendig?
Hersteller bewerben ihre Produkte gerne mit Zahlen, die jedoch selten eine hohe Aussagekraft besitzen. Ihr solltet euch gut überlegen, ob ihr die 96 oder 192 kHz Samplerate, mit der manche Systeme arbeiten können, tatsächlich benötigt. Schließlich bedeutet das, dass für alles die doppelte oder vierfache Leistung und der doppelte oder vierfache Speicherplatz benötigt wird. Der wesentliche Gewinn bei der Arbeit mit hohen Samplingrates liegt darin, dass im A/D-Wandler mit flacheren Anti-Aliasing-Filtern gearbeitet werden kann, was die negative Beeinflussung des Nutzsignals verringert. Außerdem können vor allem digitale EQs hochwertiger arbeiten. Ist die CD das Zielmedium, sollte von Beginn an unbedingt mit einem ganzzahligen Vielfachen der Samplerate gearbeitet werden, also besser 88,2 kHz statt 96 kHz. Die sonst notwendig werdende Interpolierung verschlechtert das Signal in jedem Fall! Zudem sollte man sich vor Augen halten, dass Double- oder Quad-Rate-Interfaces für diese Abtastgeschwindigkeiten optimiert wurden. Viele klingen mit 44,1 kHz schlechter als die “normalen” Audiointerfaces! Natürlich gilt es zu klären, ob die Software und der Treiber hohe Samplerates überhaupt unterstützt.

Eine Auflösung von 24 Bit ist mittlerweile quasi Standard
Mittlerweile ist eine Quantisierung mit 24 Bit Usus. Eine Abtastung des Analogsignals mit einer Auflösung von 24 Bit bedeutet nur, dass die Information, die den Wandler verlässt, aus 24 Nullen oder Einsen besteht – und sonst nichts. Eine pauschale Qualitätsaussage ist das nicht! Tatsächlich ist es aber so, dass 24-Bit-Wandler meist einen höheren Rauschspannungsabstand haben, was nicht zuletzt das Pegeln vereinfacht. Allerdings können manche Quellen (Mikrofone, Synthesizer) diese Dynamik überhaupt nicht vollständig ausschöpfen oder werden schon komprimiert aufgezeichnet. Dazu kommt, dass die Qualität der Wandler sich in Werten ausdrückt, von denen selten in der Werbung die Rede ist. Dies sind vor allem die verschiedenen Fehler, die die Bauteile generieren. Soll bedeuten: Es gibt 16-Bit-Wandler, die um ein Vielfaches besser als manche 24-Bit-Wandler klingen. Es ist nicht selten, dass in Multi-I/O-Interfaces sogenannte “Interleaving”-Wandler eingesetzt werden; meist werden acht Kanäle von einem Chip nacheinander (!) gewandelt. Wer solche Resultate mit hochklassigen externen Stereo-Wandlern in einem Test klanglich gegeneinander vergleicht, versteht, dass die Kommaverschiebung des Preises um bis zu drei Stellen nach links oft durchaus gerechtfertigt ist.
Latenzen gilt es möglichst zu vermeiden oder minimieren
Die Latenz bezeichnet die Zeitverzögerung zwischen eingehendem und ausgehendem Signal oder nur einem der beiden. Wichtig wird dies bei der Arbeit mit Softwaremonitoring (oft nicht nötig) und beim Einspielen von Musik über eine MIDI-Tastatur. Die angegebenen minimalen Latenzen werden oft nur unter Laborbedingungen und unter enormer Belastung des Rechners erreicht, außerdem addieren sich eine Menge unterschiedlicher Verzögerungen zur Gesamtlatenz. Dies sind neben Zwischenspeichern der Hardware auch Software-Buffer und Verzögerungen, die durch die A/D- und D/A-Wandler entstehen. Hier gilt es (wenn möglich), vorab zu testen, Herstellerseiten und Foren nach Informationen und Erfahrungsberichten abzugrasen oder auf Komplettsysteme mit eventuell zugesicherter Latenz zurückzugreifen.
Tischgerät oder 19″ Rackeinbau?
Sicherlich muss man sich als Nutzer auch Gedanken um ganz allgemeine, praktische Kriterien machen: Lässt sich das Gerät ins 19″-Rack einbauen, oder kaufe ich eine weitere kleine Kiste, die zwischen anderen und einer Menge Kabelage auf meinem Arbeitstisch herumliegt? Möchte ich das Gerät mitnehmen können, sind dagegen 19 Zoll Ausmaße, die mit Laptoptasche oder Rucksack oft unvereinbar sind. Wie sieht es aus mit der Gestaltung der Frontplatte? Ist dort alles so gedrängt, dass man das Gerät nur mit der Feinmotorik eines Uhrmachers bedienen kann? Kann man die Beschriftungen auch bei Bühnenbeleuchtung erkennen, oder ist die Gefahr groß, dass man Potis und Schalter verwechselt? Außerdem sollte man sich überlegen, wo im Setup die Anschlüsse sinnvoll sind. Was nutzt es, wenn die Line-Ins auf der Frontplatte zu finden sind, man aber keine Patchbay besitzt und das Gerät im Rack installieren will? Man kann bei Interfaces mit vielen Anschlüssen und einer Bauhöhe von einer Einheit (“HE”) übrigens fest damit rechnen, dass das Umstecken von Kabeln im eingebauten Zustand zur Nervenprobe wird, vor allem wenn direkt darüber oder darunter andere Geräte mit einer großen einbautiefe installiert sind.
Praktische Zusatzfunktionen und Anzeigen
Einige Hersteller sind so freundlich, auf einem Display vernünftiges Level-Metering zu ermöglichen. Das ist keine Spielerei, sondern äußerst sinnvoll, denn nur eine “Signal” und eine “Over”-LED ist als Ausstattungsmerkmal schon arg dürftig.
Manche Geräte unterscheiden sich von andern dadurch, dass sie Aufgaben anderer Geräte in sich vereinen. Momentan findet man häufig Interfaces mit Controller-Funktion oder sogar Mischpult-Interface-Hybride. Vorteil: Ihr benötigt dann nur noch eine statt zwei oder drei Kisten. Nachteil: Es gibt keine Möglichkeit, einzelne Geräte nachzukaufen, wenn es etwas mehr oder besseres Equipment sein soll oder eine Komponente den Dienst verweigert.

Unterstützung durch eigenen Prozessor, Kaskadierbarkeit und aktuelle ASIO-Treiber
Es gibt Interfaces, welche ihren eigenen, kleinen Prozessor mitbringen, welcher einfache Mixing-Aufgaben erfüllen können. Manche Geräte ermöglichen einfache stand-alone Mixes oder aufwändiges Cue-Mixing (das bedeutet Monitor-Mixing), was im Livebetrieb oder bei der Aufzeichnung von Schlagzeug durchaus vorteilhaft sein kann. Oftmals wird dafür die One-Knob-Per-Function-Philosophie geopfert, aber der erweiterte Funktionsumfang macht das wieder wett.
Einige Geräte lassen sich kaskadieren: Reicht die Anzahl Inputs oder Outputs nicht aus, lässt sich einfach ein weiteres dazukaufen und anschließen. In diesem Fall gilt es, das Setup vor dem Kauf unbedingt zu testen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Kaskadierung wird längst nicht immer von Betriebssystem, Treiber und Audio-Software akzeptiert! Oft müssen alle Interfaces dem Rechner wie ein Einziges erscheinen.
Fast alle Interfaces werden unter OS X per Core Audio angesprochen, welches durch flexible Handhabung von Samplerates, Unterstützung mehrkanaliger I/Os (für Surround!), interner 32-Bit-Fliesskomma-Architektur, Verarbeitung von linearen PCM- und non-linearen Signalen und vielem mehr glänzt. Die Umschaltung zwischen verschiedenen Interfaces, das Konfigurieren und das Handling von Presets erweist sich als kinderleicht. Selbstverständlich sollte man in Erfahrung bringen, ob das Traum-Interface überhaupt am Mac nutzbar ist.
Windows-PC-Anwender sollten auf einen aktuellen ASIO-Treiber achten, also für ASIO Version 2.8. Gerade auf Windows-Rechnern ist es sicherer, sich vor dem Kauf auf Herstellerseiten und in Foren zu informieren, ob die Kombination Interface-Chipsatz-Betriebssystem-Audiosoftware lauffähig ist. Aber selbst dann kann es passieren, dass man unglücklicherweise eine Kombination wählt, die problematisch ist und bisher nicht bekannt war. Und “Schuld” ist in diesem Fall keiner der Hersteller, denn ihre Systeme alleine verursachen keine Fehler und laufen in anderer Konfiguration problemlos. Hinsichtlich des Pre- und Post-Sales-Supports gibt es gewaltige Unterschiede! Ein Blick auf die Internetseite hilft! Gibt es ein moderiertes Technik-Forum, eine gute FAQ-Seite? Eine Alternative stellen so genannte “Turnkey”-Systeme an, also “schlüsselfertige” Audio-PCs, die natürlich etwas teurer und nicht grenzenlos individualisierbar sind, aber dafür mit einer Gewährleistung für das gesamte System geliefert werden.
Wenige Hersteller gehen den Weg einer Insellösung, bei der die Nutzung der Software an die Hardware gekoppelt ist und umgekehrt. Durch eingeschränkte Flexibilität ist hier eine höhere Stabilität möglich, aber diese Politik verhindert Flexibilität, was bei wechselnden Setups (Arbeit in verschiedenen Umgebungen, Übernahme fremder Projekte bzw. deren Weitergabe) sehr nervenraubend sein kann.
Nahezu alle Hersteller bieten eigene Kontroll-Software an, die manchmal etwas zu peppig und unübersichtlich erscheint. Mitgelieferte Plug-Ins sind oft Verkaufs-Gimmicks und keine “wertvollen Software-Pakete”, wie in der Werbung manchmal dargestellt. Anders sieht es bei mitgelieferten Sequencern in “Light”-Versionen aus, die für eine Vielzahl von Anwendungsfeldern durchaus ausreichen. Außerdem ist dort die Einbindung der spezifischen Hardware “fest einprogrammiert” so dass mit weniger Problemen zu rechnen ist. Ein derartiges Bundle ist zudem aus preislichen Gründen eine Überlegung wert!
Fazit
Es gilt also, eine Vielzahl von Faktoren gegeneinander abzuwägen. Ein wichtiger Faktor ist natürlich der Geldbetrag, der zur Verfügung steht. Ihr solltet bedenken: Die etwas teureren Firmen haben ihren guten Ruf nicht so ohne weiteres erlangt, sondern sich im Laufe der Zeit hart erarbeitet.
Schon vor dem eigentlichen Erscheinungstermin ein vollmundig angekündigtes Interface zu ordern, kann enorm daneben gehen: Ohne Erfahrungen mit diesem Gerät werdet ihr schnell wider Willen zum zahlenden Beta-Tester gemacht (Immerhin können so gut wie alle Geräte ein Firmware-Update über die Datenleitung erhalten, wenn wirklich einmal der Wurm drin sein sollte). Außerdem sinken die Preise in den ersten Wochen doch oft erheblich. Möglicherweise erfüllt auch das Vorgängermodell für die Hälfte des Preises genau eure Ansprüche. Und ansonsten gilt wie beim Autokauf: Informieren, Testberichte lesen, überlegen, ob man alle Features braucht und mitbezahlen möchte, Nutzer nach Erfahrungen und Händler nach Garantien fragen, und -das ist das wichtigste- keinen Impulskauf tätigen, sondern mit einer individuellen Checkliste den Kreis der in Frage kommenden Geräte so lange eingrenzen, bis ein oder zwei übrig bleiben.




























